Forken will wohlüberlegt sein. Lieber die eigenen Ambitionen mal zurückschrauben und sich lieber bestehenden Projekten anschließen, damit der Linux-Desktop nicht vollends zerfleddert. Diesen Appell richtet Thorsten Leemhuis gerade an alle im Open-Source-Bereich tätigen Hobby- und Profiprogrammierer. Das klingt vernünftig und entspricht vordergründig dem, was viele Anwender oftmals denken, wenn sie davon hören, dass der 5. Fork gerade zum sechsten Mal aufgegabelt wird.
Schaut man jedoch mal, was passiert bzw. nicht passiert wäre, wenn Programmierer in der Vergangenheit stets nur bei Bestehendem mitgemischt hätten statt Projekte zu forken oder Parallelentwicklungen zu beginnen, dann kommt man doch ins Grübeln.
Hätte Gnome bei KDE mitgemacht, gäbe es heute nur KDE. Hätte Olivier Fourdan bei FVWM mitgemacht, gäbe es jetzt kein XFCE. Hätte PcMan bei XFCE/Thunar mitgemacht, gäbe es heute kein LXDE. Hätten alle bei Blackbox mitentwickelt, wären weder Fluxbox noch Openbox entstanden. Hätten sich alle mit Gnome 3 abgefunden, gäbe es weder Cinnamon noch Mate oder Consort DE. Hätte Mark Shuttleworth nur Debian gesponsert, gäbe es kein Ubuntu. Ohne Ubuntu keine Ubuntu-Ableger. Nicht mal Ubuntuusers.
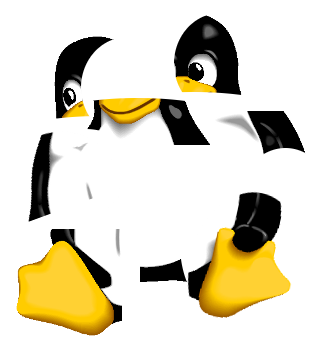
Viele Entwicklungen entwickeln sich naturgemäß nicht weiter oder erfahren keine große Resonanz. Aber andere Projekte nehmen ihren Lauf, werden zu etwas Größerem als ursprünglich geplant oder übertreffen sogar den ursprünglich Geforkten um Längen in Reichweite oder Bekanntheit. Dabei muss man nicht einmal an Ubuntu denken. Bestes Beispiel: XFCE. Als simples Panel als Ergänzung zu FVWM begonnen, ist es heute ein kompletter Desktop. LXDE wiederum besteht sogar fast zu 100% aus geforkten Anwendungen, die ihrerseits wiederum aus Forks (Openbox statt Blackbox etwa) bestehen. Hätten alle Entwickler stets immer nur bei bestehenden Projekten angeklopft und sich eingebracht, wäre der Linux-Desktop als solcher womöglich tatsächlich weiter, aber da dies auch immer mit einer Einigung auf einen gemeinsamen Nenner einherginge, wäre die Linuxlandschaft heute auch deutlich ärmer an Möglichkeiten. Diese Vielfalt, wie sie bei Linux und Open Source im Allgemeinen möglich ist und auch tatsächlich existiert, wäre nie entstanden.
Aktuell kommt nun die Kritik am 3. Gnome-Fork, an Consort. Doch was ist, wenn Cinnamon und Mate irgendwann in einer Sackgasse enden und Consort sich als der zukunftsträchtigste Weg erweist? Dann wäre eine potentielle Erfolgsstory schon jetzt im Keim erstickt worden. Natürlich liegt es nahe zu sagen, „macht doch lieber bei Mate mit“, doch die Gründe der Macher, es eben nicht zu tun, sind durchaus plausibel: Cinnamon baut auf aktueller Gnome-Technik auf, um Gnome 2 nur nachzubilden, Mate hingegen bleibt bei der älteren Technologie stehen und versucht sie zu erhalten. Consort wiederum will wieder einen Mittelweg gehen. Es nimmt nur die Kernkomponenten des alten Gnome 2 bzw. den Fallback-Mode von Gnome 3, also Fenstermanager, Dateimanager und Panel, und konzentriert sich auf die Weiterentwicklung dieser Module.
Damit wird auf Bewährtes aufgebaut, dies aber in realistischerem Umfang mit einer besseren Zukunftsprognose, als Mate dies derzeit verspricht. Selbst wenn es diese Gründe nicht gäbe – wenn es dieser erneuten Abspaltung irgendwann gelingt, zu einem richtig tollen Desktop zu werden, dann hat sich die abermalige Abspaltung absolut gelohnt. Wenn es nicht gelingt, weil die Manpower fehlt, dann ist das noch längst keine Garantie, dass die Ressourcen in einem Schwesterprojekt besser investiert gewesen wären. Was nicht heißt, dass auseinandergedriftete Projekte zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder zusammenfinden können, wie beispielsweise Compiz Fusion/Beryl und Compiz gezeigt haben.
Was durchaus stimmt, ist, dass es für die Anwender schwieriger wird, sich in dem Geflecht von Projekten, Abspaltungen und ihren Anwendungen noch zurechtzufinden. Schon jetzt muss sich ein Linux-Anwender nicht nur für eine von Dutzenden Distributionen entscheiden, sondern auch, ob er diese lieber mit KDE, Gnome, XFCE, Cinnamon, LXDE oder sonstwas betreiben möchte. Und auch bei den einzelnen Programmen hört es nicht auf: Open Office oder Libre Office? Es wird zunehmend verwirrender, je weiter sich eigentlich verwandte Programme auseinanderentwickeln. Aber es ist eine Verwirrung, die nur dann zuschlägt, wenn man sie auch in Kauf nehmen will. Jemand, der sich für Hintergründe nicht interessiert, nimmt einfach das Linux, also etwa ein Ubuntu – und damit das, was ihm der jeweilige „Marktführer“ vorsetzt. Das ist die traditionelle Aufgabe einer Distribution. Wer dann damit nicht zufrieden ist, sucht sich Alternativen – und die hat er dann haufenweise, eben gerade dank der Fork-Willigkeit der Entwicklergemeinschaft.
Dass Entwickler primär ihre Potentiale bündeln, um an etwas großem Ganzen gemeinsam zu entwickeln, das wird ein frommer Wunsch bleiben. Weil es ein theoretischer Wunsch ist, ein Gedankenspiel. Freie Menschen streben mitunter danach, sich frei zu verwirklichen, ihren Ideen ohne Einschränkungen nachgehen zu können, Einschränkungen, die durch die Vorstellungen anderer (in einem gemeinsamen Projekt) durchaus mehr oder weniger hinderlich sein können. Auf diese Weise verderben nicht viele Köche den Brei, sondern jeder kann Küchenchef sein und sein eigenes Süppchen kochen. Für den Anwender bedeutet dies im Ergebnis, sich aus einem reichhaltigen Buffet das für ihn Wohlschmeckendste heraussuchen zu können, statt den zwar größeren, aber auch faderen Einheitsbrei schlucken zu müssen. Wer könnte ernsthaft etwas dagegen einwenden wollen?



